
Unsere Veranstaltungen
Seminare, Konferenzen, Treffpunkte...
Die aktuellen Anhörfassungen der beiden Kerncurricula für das Fach "Christliche Religion nach evangelischen und katholischen Grundsätzen" (GS und Sek I) sind veröffentlicht worden und hier digital einsehbar. Die zweite, verkürzte Anhörung läuft bis zum 28.03.
Testet unser neues Demokratie-Modul und gewinnt tolle Preise! Die Evangelische Jugend in der Landeskirche Hannovers sucht Konfi- und Jugendgruppen, die Lust haben, unser neues Modul zum Thema „Demokratie“ in der Konfiarbeit auszuprobieren.
Zur Vokationstagung im RPI Loccum vom 16. bis 18. Februar kamen Lehrkräfte aus allen Schulformen und Regionen Niedersachsens und den Kirchen der Konföderation zusammen. Eine Vokation ist die kirchliche Bestätigung der evangelischen Religionslehrkräfte zur Erteilung von Religionsunterricht.
Raus aus der Bubble – rein in die Vielfalt der Konföderation
Da tagten junge Religionslehrerinnen aus Grundschulen neben Kolleginnen aus Realschulen und Gymnasien. Da traf ländlicher Raum auf städtische Systeme. Da wurde neu bewusst, dass es kleine Kollegien mit sechs Lehrkräften ebenso gibt wie große Schulen mit über hundert Kolleg*innen. Diese Vielfalt war nicht nur organisatorischer Rahmen, sondern inhaltlicher Gewinn.
Viele beschrieben den Perspektivwechsel als besonders wertvoll. „Es tat gut, die eigenen Themen einmal in einem größeren Zusammenhang zu sehen, andere Sorgen zu hören und zu merken, dass Herausforderungen geteilt werden – wenn auch unter ganz unterschiedlichen Bedingungen“, so Anna Louisa Hundertmark, die an der Theodor-Heuss-Realschule in Hameln unterrichtet.
„Wir kamen endlich mal raus aus der eigenen ‚Bubble‘, hinein in ein Gespräch über Schule, Kirche und Gesellschaft – Themen, die uns alle betreffen“, ergänzt Onno Rüther vom Gymnasium Buxtehude Süd. Gerade diese Weite hat die Tagung geprägt. ...

Stephanie Riese ist die neue Koordinatorin für das Entwicklungsprogramm „Familienorientierte Kirche“.
Wir im RPI freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. Für ihr neues Wirken und die weiteren Schritte auf dem Weg zu Familienorientierter Kirche wünschen wir ihr wache Blicke, tätige Hände, kluge Perspektiven und natürlich Gottes Segen.
Liebe Stephanie, magst du dich kurz vorstellen?
In den letzten siebeneinhalb Jahren war ich als Diakonin in der Kirchengemeinde Hanstedt im Kirchenkreis Winsen tätig.
Mit meinem Partner und unseren beiden Kindern lebe ich auf einer Forellenteichwirtschaft in der Nähe von Bispingen in der Lüneburger Heide.
Seit dem 1. Dezember 2025 bin ich Koordinatorin für das Entwicklungsprogramm Familienorientierte Kirche.
Warum hast du dich für diese Tätigkeit entschieden?
Familienorientierung lag mir bereits in meiner vorherigen Stelle am Herzen und ich finde es großartig, dass sie nun so grundlegend von Kirchenkreisen der Landeskirche Hannovers in den Fokus genommen wird und ich diese dabei begleiten darf. Ich hoffe, neben meinen praktischen Erfahrungen aus der Gemeinde einige gute Gedanken aus meinem tätigkeitsbegleitenden Studium einfließen lassen zu können....
25 Jahre Lernwerkstatt – und aktuelle Ausstellung zu „Fair-Gleichnissen“
Etwas verborgen, im Keller des RPI Loccum, liegt ein echter Schatz: Die Lernwerkstatt. Seit nunmehr 25 Jahren ist sie ein Ort voller Ideen, vielfältiger religionspädagogischer Impulse und immer neuer Inspirationen. Wer sie betritt, spürt sofort: Hier wird mit Herz, Kreativität und Leidenschaft gearbeitet.
Die Lernwerkstatt bietet eine beeindruckende Fülle an Materialien und Methoden rund um die Religionspädagogik.
Halbjährlich entsteht eine neue Ausstellung – entwickelt und gestaltet von einem engagierten Team aus rund 15 Religionslehrkräften. Einige von ihnen sind seit der ersten Stunde dabei, andere kamen im Laufe der Jahre dazu. Alle eint die Freude daran, Religion lebendig und anschaulich zu vermitteln. Detailverliebt und mit einem sicheren Gespür für die Anliegen der Unterrichtspraxis bringen sie Impulse ein, die erprobt, sofort umsetzbar und zugleich inspirierend sind.
Begleitet wird das Lernwerkstatt-Team traditionell durch die Dozentin für den Bereich Grundschule am RPI Loccum. Diese Rolle hatte im Gründungs-Jahr 2000 Lena Kuhl. Auf sie folgten Beate Peters und anschließend Lena Sonnenburg. Seit kurzem liegt die Begleitung in den kompetenten Händen von Kreske van Wezel.
Der 25. Geburtstag der Lernwerkstatt wurde zum Anlass genommen, das Team mit einer kleinen Feier und einem ganz besonderen Dankeschön zu würdigen: einem eigens gestalteten Zollstock mit dem Satz „Bei Gott wird anders gemessen.“ Ein Symbol für den Blickwinkelwechsel, der Religionsunterricht und besonders die Lernwerkstatt seit jeher prägt....
Jede Woche neue Fragen und Themen? Prof. Wolfgang Reinbold ist Beauftragter für Interreligiösen Dialog der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Er hat schon über 200 Videos veröffentlicht, zuletzt auch auf TikTok und Instagram (sowie bei ProSieben und im Radio). In gut einer Minute bringt er Erhellendes auf den Punkt.
In seinen Büchern "Warum ist der Budda so dick?" und nun "Warum ist Weihnachten am 7. Januar?" nimmt Prof. Reinbold 101 Fragen auf und bietet zusätzlich zum Text QR-Codes mit Links zu den Videos.
Die schön gestalteten Büchern sind auch als Geschenke gut geeignet.
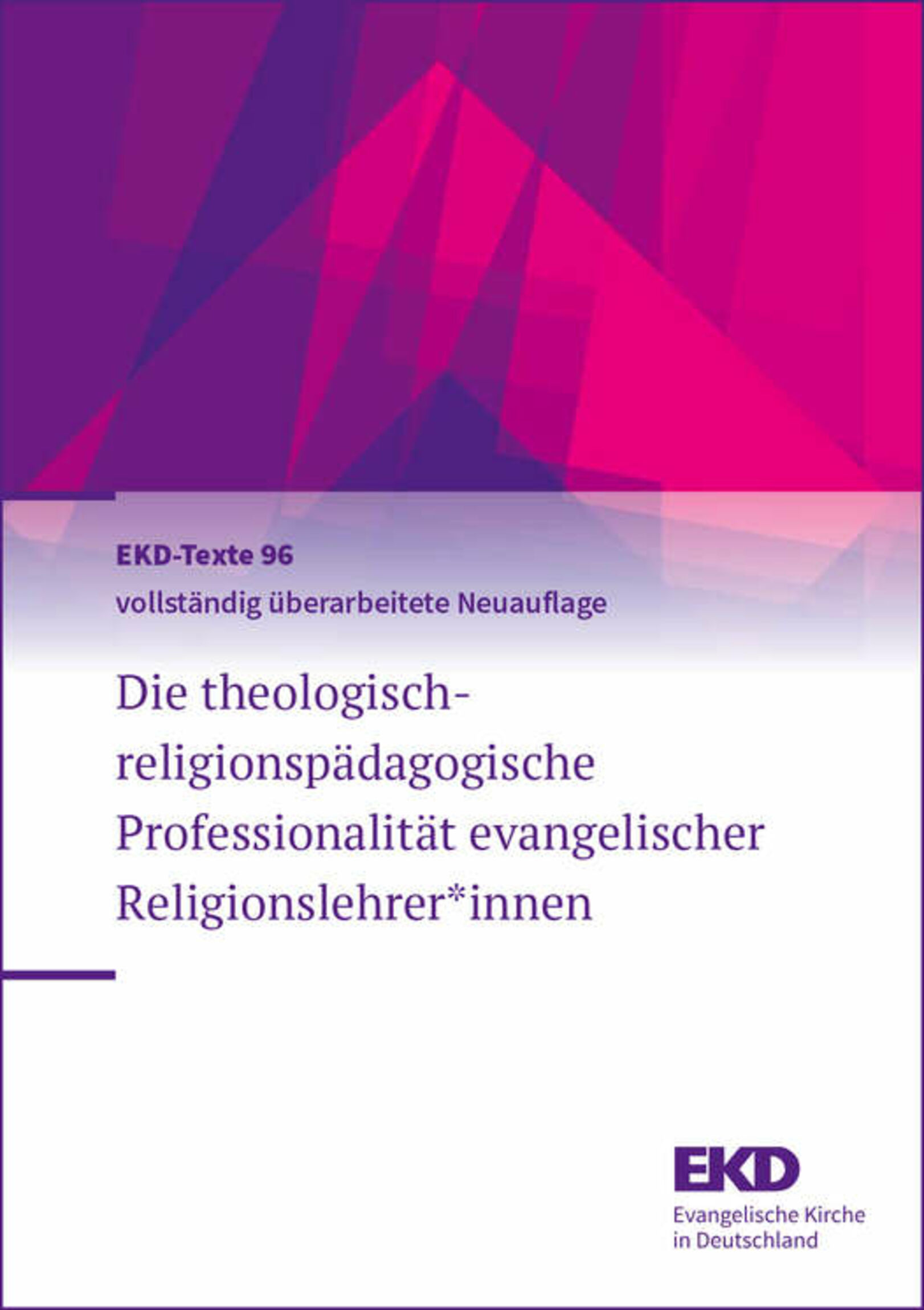
Neues Rahmenkonzept für Aus-, Fort- und Weiterbildung von Religionslehrer*innen
Angesichts der sich drastisch verändernden Kontexte in Kirche, Schule und Gesellschaft wurde der EKD-Text 96 unter dem Titel „Die theologisch-religionspädagogische Professionalität evangelischer Religionslehrer*innen“ vollständig überarbeitet und aktualisiert.
Die überarbeitete Neuauflage des EKD-Texts 96 zur Ausbildung evangelischer Religionslehrkräfte berücksichtigt aktuelle gesellschaftliche und pädagogische Entwicklungen. Professionalität wird als Zusammenspiel von Fachwissen, pädagogischer Kompetenz, persönlicher Haltung und Reflexionsfähigkeit verstanden. Der Text fordert Anpassungen auf allen drei Ebenen der Lehrer*innenbildung ein, damit Religionslehrkräfte als selbstreflektierte, dialogoffene und transparent auftretende Fachleute zu agieren lernen. Ziel ist ein fachlich fundierter und lebensbedeutsamer Religionsunterricht.
Robert Rathke kennt viele Seiten des beruflichen Lebens: Die Universität, das Klassenzimmer, die Bundeswehr und die Kirche. Der 32-Jährige absolviert derzeit seine Schulphase im Vikariat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers und unterrichtet Religion an der katholischen Haupt- und Realschule Albertus-Magnus in Hildesheim. Für ihn ist das mehr als eine Pflichtübung:
„In der Schule kann ich jungen Menschen begegnen, ihnen zuhören und sie in ihrer Lebenswirklichkeit ernst nehmen. Das ist eine große Chance.“
Ursprünglich hatte Rathke einen anderen Weg eingeschlagen. Nach dem Abitur begann er 2013 ein Studium in Hildesheim mit den Fächern Wirtschaft und Geschichte für das Realschullehramt. 2017 reiste er erstmals nach Israel und Palästina – ein prägendes Erlebnis, das ihn tief berührte und ihn zur späteren Teilnahme am Theologischen Studienjahr in Jerusalem motivierte. Auch der Kontakt zu der damaligen Hildesheimer Hochschulpastorin bewegte ihn. Sie meldete ihn zur Lektorenausbildung an, welche in ihm den Wunsch wachsen ließ, Theologie zu studieren.
„Da hat ein Feuer in mir gebrannt, das ich nicht mehr losgeworden bin“, erinnert er sich. 2018 nahm er das Theologiestudium in Göttingen auf; parallel dazu absolvierte er eine Offiziersausbildung bei der Bundeswehr.
Heute brennt er für die Kirche und die Menschen vor Ort. ...
Symposion, Kunst, Musik und feierlicher Gottesdienst prägten das Festwochenende
Das Religionspädagogische Institut Loccum der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers beging am Wochenende vom 26. bis 28.09.2025 sein 75-jähriges Bestehen mit einem vielfältigen Symposium. Unter dem Titel „Religiöse Bildung für die Zukunft: Resonanz. Transformation. Zuversicht.“ kamen rund 130 Menschen aus Kirche, Schule, Universität in Loccum zusammen.
Mit den Aufgaben und Themen, welche das RPI auch im Auftrag der Konföderation gestaltet, versteht sich das Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitut seit 75 Jahren als Impulsgeber für religionspädagogische Entwicklungen. Das Jubiläum wurde zum Anlass, fachlichen Input und Austausch, Vernetzung und Feiern an einem traditionsreichen Lern- und Begegnungsort zu ermöglichen.
Lebendige Vorträge und angeregte Diskussionen
Zum Auftakt charakterisierte Rektorin Silke Leonhard das RPI Loccum als Gewächshaus: „Bildung braucht Religion – Religion braucht Bildung. Ohne gesunde Pflanzenzucht hätte religiöse Bildung wenig nahrhafte Lebens-Mittel und Kirche wäre arm.“
Zu den Redner:innen zählte Ulrich Schnabel, der mit seinem Vortrag „Religion als Resonanzerfahrung“ die Keynote der Tagung gestaltete.
Weitere Referent:innen waren u.a. EKD-Vizepräsident Stephan Schaede, die universitären Religionspädagog:innen Ulrike Witten (München), Michael Domsgen (Halle), Marcell Saß (Marburg), Konstantin Lindner (Bamberg) und Bernd Schröder (Göttingen) sowie Kerstin Gäfgen-Track (Landeskirchenamt und Konföderation), Miriam Heuermann (Service Agentur Landeskirche) und Katrin Gladen (Bistum Hildesheim). Ihre Beiträge wurden als lebendig, inspirierend und diskussionsfreudig wahrgenommen und führten zu anregenden Gesprächen der Teilnehmenden. Auch die gut besuchten Workshops der Dozent*innen des RPI standen im Zeichen intensiven Austauschs. ...
Seine Kunst hat Sprengkraft! Sie sprengt die Genre-Grenze von Malerei und Musik, schafft es scheinbar mühelos, das eine mit dem anderen zu verbinden und beides wechselseitig ineinander aufgehen zu lassen. Die Bilder sind alles andere als stumm oder eindimensional. Sie lassen sich nicht quasi neutral ‚konsumieren‘ oder rein kunstwissenschaftlich analysieren, sondern wollen uns ‚packen‘, uns persönlich und emotional ansprechen. Jürgen Borns „Jazz Colours“-Bilder demonstrieren eindrucksvoll, dass Musik uns ganzheitlich anspricht, bewegen und erreichen will und dass Malerei mehr ist als Farbe und Form auf einer Fläche. Seine Klangbilder berühren unmittelbar. Seine gemalte Musik ist einfach im wahren Wortsinne attraktiv, zieht uns an und mitten hinein in das Geschehen – der Kunst, des Lebens, der Live-Performance.
Den „Jazz Colours“-Bildern ist deutlich anzumerken, ja abzuspüren, dass hier jemand malt, der selber begeistert ist von seinen Sujets und ihrer Leidenschaft für Musik. Ein Künstler, der die Musik, die Musiker*innen liebt, die er ‚abbildet‘, deren Klänge er in Farbe und Form überführt. ...
Rektorin Prof. Dr. Silke Leonhard freut sich besonders, dass die Ausstellung der Jazz Colours-Klangbilder auch genau den Zeitraum ab Ende September umfasst, an dem das RPI sein 75-jähriges Jubiläum begeht und feiert: „Jürgen Borns Kunst weckt Resonanzen. Den Klang und die Bewegtheit der Musik kann man in seinen Klangbildern sehen und fast hören. Und auch im RPI geht es um vielfältige Resonanzen: Manche regen wir mit unserer Arbeit an, einige werden in Loccum durch Begegnungen mit Menschen, Ort und Dingen erfahren.“
Eine Auswahl der Musiker lässt sich auf dem Campus mithilfe von QR-Codes anhören.
In Niedersachsen gibt es bald ein neues Schulfach: Die evangelischen Kirchen und katholischen Bistümer in Niedersachsen haben heute (05.09.2025) im Gästehaus der Landesregierung in Hannover eine Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen über die Einführung des Unterrichtsfachs „Christliche Religion nach evangelischen und katholischen Grundsätzen“ (kurz: Christliche Religion) unterzeichnet.
Anstelle der bisherigen Unterrichtsfächer Evangelische Religion und Katholische Religion wird an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen ein Religionsunterricht eingeführt, der inhaltlich gemeinsam von den katholischen Bistümern und evangelischen Kirchen in Niedersachsen verantwortet wird. Das Fach wird aufsteigend im Primarbereich und im Sekundarbereich I zum 01.08.2026 verpflichtend eingeführt. In dieser Form ist das Fach einmalig in Deutschland.
„Mit dem neuen Fach ‚Christliche Religion‘ setzen wir ein wegweisendes Zeichen für Dialog und Kooperation. Ein gemeinsam verantworteter Religionsunterricht ist gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges zeitgemäßes Signal: Er eröffnet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, über Vielfalt und Unterschiede nachzudenken und Respekt sowie Toleranz gegenüber anderen zu entwickeln. Auf diese Weise wird das neue Schulfach ‚Christliche Religion‘ nicht nur einen wichtigen Beitrag zur religiösen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen leisten, sondern zugleich die demokratischen Werte, die unser Zusammenleben prägen, deutlich stärken“, sagt Kultusministerin Julia Willie Hamburg, die die Vereinbarung für das Land Niedersachsen unterzeichnet hat. ...
Kreske van Wezel neu am RPI Loccum – Dozentin für den Grundschulbereich
Seit August 2025 ist Kreske van Wezel neue Dozentin für den Bereich Grundschule am RPI Loccum. Sie bringt vielfältige Erfahrungen und große Leidenschaft für religiöse Bildung mit.
Kreske van Wezel studierte in Hamburg, wo sie auch mit dem „Religionsunterricht für alle – RUfa“ in Berührung kam – ein Ansatz, der sie bis heute mit prägt. Seit 2009 war sie als Religionslehrerin an verschiedenen Grundschulen tätig. In den letzten beiden Jahren arbeitete sie als Fachseminarleiterin für das Fach Englisch am Studienseminar Wunstorf und begleitete angehende Lehrkräfte auf dem Weg in den Beruf.
Schon als Jugendliche engagierte sie sich in der Kinderkirche, auf Kirchenfreizeiten, in Jugendgruppen und bei Familiengottesdiensten – Erfahrungen, die ihr Verständnis von religiöser Bildung auch außerhalb des Klassenzimmers bis heute formen. „Die Religionspädagogik zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben“, beschreibt sie selbst ihre Motivation. Umso mehr freut sie sich, dass auch die Betreuung der Lernwerkstatt am RPI zu ihren Aufgaben gehört – ein Ort, an dem Theorie, Praxis und Kreativität zusammenkommen.
Ein besonderer Schwerpunkt ihrer zukünftigen Arbeit liegt in der Einführung und Ausgestaltung des kommenden neuen Unterrichtsfaches Christliche Religion (RC) für die Grundschule. (...)
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr, auf viele neue Impulse und ein gemeinsames Engagement für die religiöse Bildung, besonders an Grundschulen.
Bianca Reineke, Öffentlichkeitsarbeit am RPI Loccum
Im Jubiläumsjahr des Religionspädagogischen Instituts Loccum gibt es viele besondere Momente – einer davon war die feierliche Namensfindung und -gebung unserer Pelikan-Symbolfigur, die seit Kurzem das RPI mit charmanter Präsenz bereichert.
Ihr Name: Perla Pelikan!
Die Namenssuche war ein gemeinschaftliches Projekt, das Herz und Humor vereinte. Beim Abend der Begegnung und im Café Bildung auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2025 sowie direkt im RPI sammelten wir zahlreiche kreative Namensvorschläge – von Kindern und Erwachsenen, von Gästen, Mitarbeitenden und Freund*innen des Hauses.
Im Anschluss wurden alle Ideen ausgewertet und es wurde abgestimmt. Das Ergebnis: Perla Pelikan setzte sich durch und wurde zum fröhlichen Botschafter unseres Jubiläumsjahres. Der Name verbindet hohe Wert-Schätzung und Freundlichkeit mit Kompetenz und Tiefe – ganz im Sinne unseres Bildungsverständnisses.
75 Jahre RPI – Bildung mit Herz, Kopf und Flügeln
Die Namensgebung von Perla Pelikan ist Teil der Feierlichkeiten rund um „75 Jahre RPI Loccum“. Seit 1949 ist das RPI ein Ort für religiöse Bildung, Begegnung und professionelle Fort- und Weiterbildung für alle religionspädagogischen Berufe. Im Jubiläumsjahr laden wir ein zum Innehalten, Feiern und gemeinsamen Weiterdenken – beim Symposion vom 26.–28. September 2025 unter dem Motto „Zukunft religiöser Bildung“, mit der vierten Jahresausgabe des Loccumer Pelikan und darüber hinaus.
Und Perla? Die bleibt! Als Symbolfigur mit Persönlichkeit und als kleines Zeichen für das, was wir am RPI großschreiben: Bildung, Gemeinschaft und Teilhabe – was beflügelt und trägt.
Bianca Reineke ist im RPI Loccum für Berufsbildende Schulen und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Religionspädagogische Langzeitfortbildung 2024/2026 Abschlusskolloquium
Gewaltfreie Kommunikation – Vertiefung und Praxisanwendungen
Schulmentor*innentag Im Rahmen der Religionspädagogik im Vikariat

Das Jahresprogramm in der Übersicht.
Auch bei uns wachsen die Kosten, dabei bleiben unsere Tagungen von kirchlicher Seite stark subventioniert.
Ab dem 1.1.2026 erheben wir eine reguläre Tagungsgebühr von 35 Euro.
Aufgrund von geänderter Bedingungen in der Tagungsstätte können kostenfreie Stornierungen ab 2026 bis zu max. 10 Kalendertagen vorher getätigt werden.
Wir bitten um frühzeitige Anmeldung bis spätestens 4 Wochen vor Tagungsbeginn.
Herzliche Einladung zum ersten digitalen Treffen mit Koordinatorin S. Riese für alle Interessierten am 26.2.2026.
Eine pdf-Version, z.B. zum Aushängen in Kirchengemeinden, finden Sie hier.
TOPTHEMA Missbrauch: Der lange Weg aus dem Schatten
Drei Fragen zu Antisemitismus… an Prof. Dr. Ursula Rudnick, Beauftragte für Kirche und Judentum bei der ev.luth. Landeskirche Hannovers.
Einfach und schnell digital konferieren für Nutzende in der Landeskirche mit https://talk.elkh.de
800 Jahre Franz von Assisi bunt feiern
Mittwoch, 18.2., 17-18.30 Uhr digital, Kirche und Kultur – eine Verbindung stärken
Weltgebetstag 6.3.2026: Motto und Bild stehen fest: „Kommt! Bringt eure Last".
Frieden ist keine Selbstver-ständlichkeit. Er muss immer wieder neu errungen, bewahrt und gestaltet werden – von der Politik, von der Gesellschaft und von jedem einzelnen Menschen. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheiten, geopolitischer Spannungen und militärischer Aufrüstung stellt sich die Frage: Welche Verantwortung tragen wir für den Frieden?
Diese Broschüre der evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden richtet sich vor allem an junge Menschen, die sich mit der Frage nach Krieg, Frieden und ihrer eigenen Haltung dazu auseinandersetzen.
Zusätzlich finden Sie hier Seiten aus dem Raum der EKD.
„Einfach mal alles rauslassen“
Seelsorge ist aus unserer Kirche nicht wegzudenken, hoch akzeptiert und
gewollt. Seelsorge ereignet sich überall: in unseren Kirchen und Gemein-
debüros, im Konfirmand*innenunterricht, auf dem Friedhof und auch als
„Kirche am anderen Ort“ im Hafen, in der Krankenhauskapelle, im Schul-
flur, im Altenheim und auf der Jugendfreizeit.
Eine Mappe beinhaltet viele Anregungen, die auch im Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Schule und Gemeinde umfassen.
Hildesheim, Bonn (epd). Betroffene sexualisierter Gewalt wünschen sich vom neuen Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, dauerhafte Aufmerksamkeit für die ...
Bremen (epd). Der Bremer Kirchenpräsident Bernd Kuschnerus hat zu ernsthaften Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe in der Ukraine aufgerufen. „Ein gerechter und nachhaltiger Friede muss das Wohl ...
Würzburg, Hildesheim (epd). Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer ist neuer Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Die Bischöfe wählten den 64-Jährigen am Dienstag in Würzburg ...
Der neue Orientierungsrahmen Globale Entwicklung vereint Perspektiven aus Schule, Bildungsverwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft für die konzeptionelle wie auch inhaltliche Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dabei wird die besondere Bedeutung zukunftsorientierter Bildung mit globaler Perspektive deutlich, wenn sie im Unterricht und in der Schule, bei der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften oder für die Entwicklung von Bildungsplänen und deren Umsetzung berücksichtigt wird.
Die Autor*innen werden die übergeordneten Kapitel sowie die 17 fächerbezogenen Kapitel vorstellen, inkl. Umsetzungsbeispielen für den Unterricht. Die Online-Workshops finden vom 2.12.2025 bis zum 30.6.2026 immer dienstags von 16:15 bis 17:30 Uhr statt
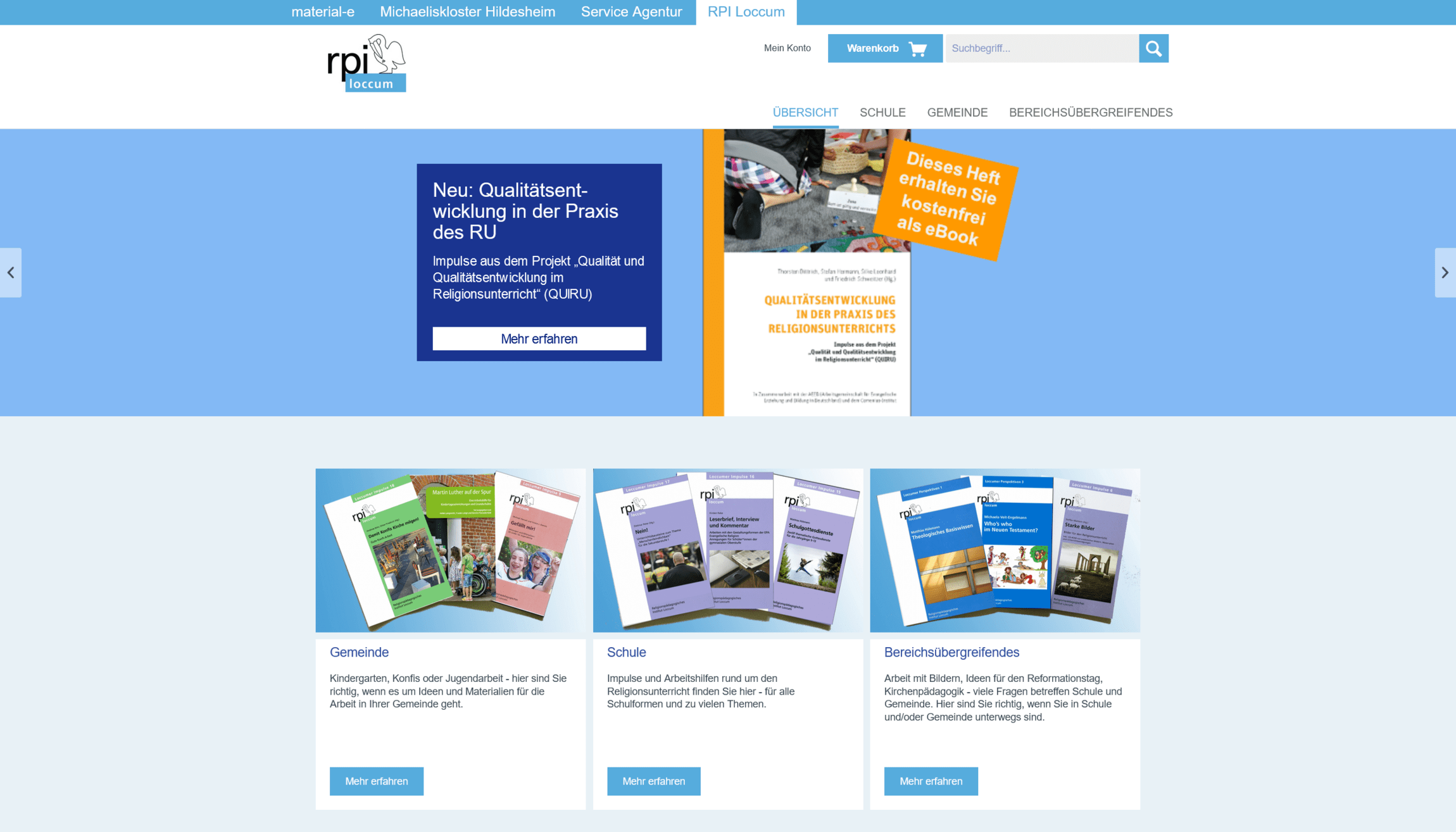
🚧 Wegen einer technischen Umstellung können Bestellungen derzeit leider nicht entgegengenommen werden. Danke für Ihr Verständnis.
Ab ca. Dezember 2025 finden Sie unsere Artikel im neuen gemeinsamen Onlineshop der Landeskirche Hannovers – zusammen mit den Angeboten vieler weiterer Einrichtungen der Landeskirche.
Wir freuen uns, Sie bald im neuen Shop begrüßen zu dürfen! 😊
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Katja.Kunsemueller@evlka.de
sinnlich – vielfältig – inklusiv
Die Broschure ist als pdf kostenlos zu lesen oder über das ptz Stuttgart zu beziehen. Sie wird bald auch in der Verkaufsstelle des RPI für 10,00 Euro (98 S.) erhältlich sein.
Impulse aus dem QUIRU-Projekt
Dieser Band wendet sich an Lehrkräfte, die Religion unterrichten – besonders in Grundschule und Gymnasium, aber auch in anderen Schularten.
Der QUIRU Praxisband als kostenloses eBook (mehr).