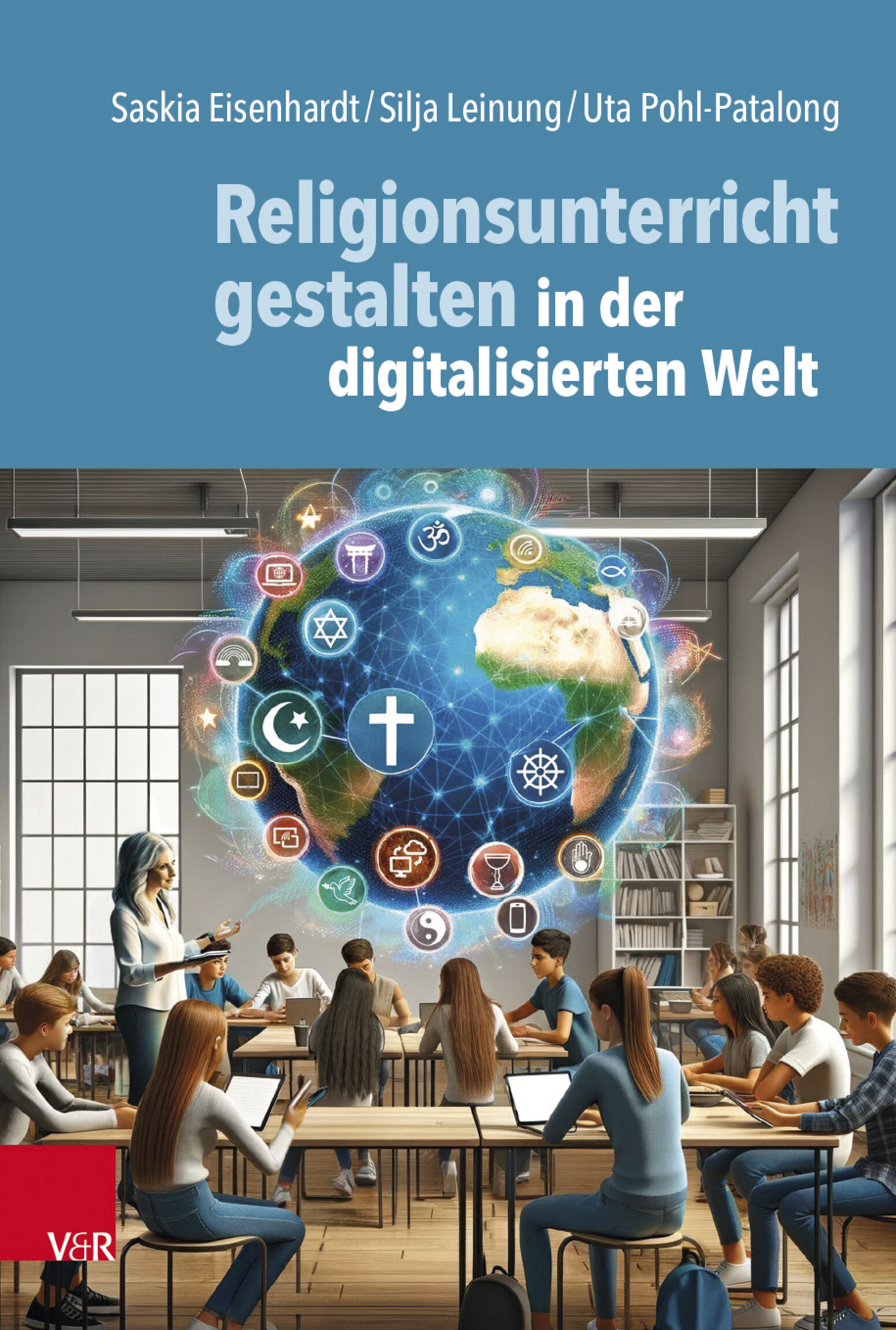Rezension
Saskia Eisenhardt, Silja Leinung, Uta Pohl-Patalong
Religionsunterricht gestalten in der digitalisierten Welt
Vandenhoeck & Ruprecht
Göttingen 2024
ISBN 978-3-525-70008-2
224 Seiten, 29,00 €
Didaktische Orientierung in der digitalen Gegenwart
Wie kann ein zeitgemäßer Religionsunterricht gelingen, der die Bedingungen der digitalen Gegenwart ernst nimmt, ohne die anthropologische Tiefe und pädagogische Nähe des Faches zu verlieren? Dieser Frage widmen sich die Autorinnen Saskia Eisenhardt, Silja Leinung und Uta Pohl-Patalong mit einem dezidierten Praxisbezug und einer beeindruckenden konzeptionellen Klarheit. Ihr Sammelband legt zehn zentrale Gestaltungsprinzipien für einen digital sensiblen Religionsunterricht vor – didaktisch verankert, theologisch fundiert und mit Blick auf eine heterogene Schülerschaft reflektiert.
Die Konzeption des Bandes ist systematisch: Jedes Kapitel folgt einem Analysemodell in sechs Schritten, das sich als didaktisch besonders tragfähig erweist – nicht zuletzt durch seine Klarheit in der Vermittlung und Konsistenz in der Anwendung. In der folgenden Rezension wird exemplarisch das Kapitel zur Inklusion herangezogen. Der Blick darauf speist sich unter anderem aus eigenen, auch familiären Erfahrungen mit inklusiven Lernrealitäten und neurodiversen Zugängen.
- Begriffsklärung & Zielsetzung: Den Einstieg bildet eine präzise Definition des jeweiligen Gestaltungsprinzips und seiner didaktischen Relevanz. In Kapitel V etwa wird Inklusion als „gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen“ (100) verstanden – mit dem Ziel, Differenz nicht zu nivellieren, sondern wertzuschätzen.
- Gesellschaftlicher Kontext & Digitalität: Es folgt eine kontextuelle Analyse, wie gesellschaftliche Entwicklungen – insbesondere die digitale Transformation – das Prinzip berühren oder herausfordern. Im Fall der Inklusion zeigt sich eine Ambivalenz: Während digitale Tools neue Teilhabeformen eröffnen, reproduzieren sie teils auch normative Ausschlussmechanismen (102–105).
- Theologische Fundierung: Im dritten Schritt erfolgt eine unterschiedlich tiefgreifende theologische Reflexion. Anhand des Inklusionsprinzips etwa werden die Gottebenbildlichkeit jedes Menschen (Gen 1), das Reich-Gottes-Motiv der Zuwendung zu Marginalisierten und das paulinische Bild des Leibes Christi (1 Kor 12) als theologische Stützpfeiler einer inklusiven Didaktik erschlossen (106–107).
- Religionspädagogischer Diskurs: In diesem Teil wird der Stand der religionspädagogischen Diskussion eingebunden. Das Kapitel zur Inklusion etwa hebt hervor, dass der RU mit seiner Subjektorientierung, Mehrdimensionalität und Kreativität besonders prädestiniert ist, individualisierte Zugänge zu eröffnen und soziale Differenz produktiv zu bearbeiten (108–110).
- Konfessioneller RU & religiöse Vielfalt: Diese Abschnitte analysieren, wie sich konfessionelle Strukturen zum Anspruch auf Pluralität und Offenheit verhalten. So wird bei der Inklusion deutlich, dass konfessionelle Trennung im Widerspruch zu inklusivem Lernen steht und interreligiöse Lernräume sinnvollere Antworten liefern könnten (111).
- Didaktische Umsetzung & Impulse: Abschließend folgen konkrete Anregungen für den Unterricht. Im Inklusionskapitel sind das unter anderem digitale Impulse zur Arbeit mit Collagen, Bibeltexten und Whiteboards. Die Verbindung von digitalem Lernen und Inklusionspädagogik wird unter dem Begriff „Diklusion“ überzeugend entfaltet (114–117).
Die durchgehende Struktur bietet einen roten Faden und ermöglicht Leser*innen sowohl selektives Lesen als auch systematische Vertiefung. Die Kapitel sind fachlich fundiert, sprachlich klar und didaktisch anschlussfähig – eine selten gelungene Kombination. Besonders hervorzuheben ist, dass die Herausgeberinnen sich nicht auf einen technikzentrierten Digitalitätsbegriff beschränken, sondern konsequent von den veränderten Weltzugängen der Schüler*innen ausgehen. Die Digitalität wird so nicht zur bloßen „Methodenzugabe“, sondern zum konstitutiven Bestandteil didaktischer Überlegungen.
Didaktisch überzeugt der Band durch seine Offenheit: Die konkreten Impulse sind nicht als fertige Stundenmodelle gemeint, sondern als flexibel adaptierbare Vorschläge, die zur Weiterentwicklung anregen. Dass auf die Nennung spezifischer Tools verzichtet wurde, erweist sich angesichts datenschutzrechtlicher Unterschiede und technologischer Schnelllebigkeit als kluge Entscheidung.
Ein kleiner, aber mir wichtiger Kritikpunkt betrifft die Perspektive auf Inklusion im Kapitel V: Zwar wird umfassend über Behinderung, Leistung, Heterogenität und differenzsensibles Lernen reflektiert – die Dimension neurotypischer versus neurodiverser Lernprofile (z. B. AD(H)S, Autismus-Spektrum, Hochsensibilität) bleibt jedoch unterbelichtet. Gerade diese Formen von Differenz bringen im schulischen Alltag ganz eigene didaktische Anforderungen mit sich – etwa in Bezug auf Reizverarbeitung, Strukturbedürfnisse oder Kommunikationsstile. Hier hätte eine stärkere Berücksichtigung die Inklusionsperspektive nochmals differenziert und vertieft; mindestens ein Hinweis für Literatur oder Internetressourcen fehlt leider, wäre aber hilfreich.
Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten: Gestaltungsprinzipien für einen digitalen Religionsunterricht ist ein sehr empfehlenswertes Werk für alle, die Religionsunterricht als schüler*innenorientierte, digital bewusste und ethisch begründete Reflexion und Praxis verstehen. Es verbindet wissenschaftliche Fundierung mit hoher didaktischer Relevanz – und macht Mut, das Fach Religion als gestaltbare Zukunftsaufgabe zu begreifen.
Felix Emrich